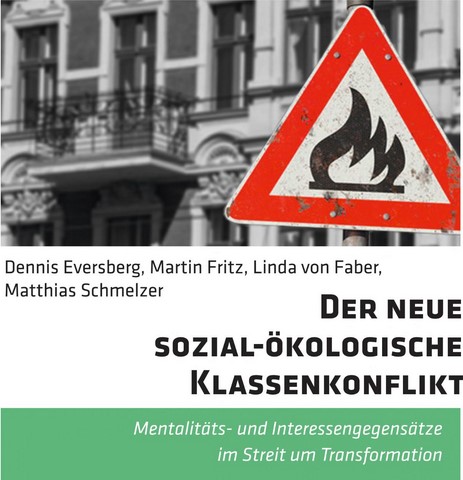
Schon beim Einlesen wird schnell klar, dass es zum umfassenden Verständnis aller Textteile eigentlich soziologischer Grundkenntnisse bedarf, zumindest aber einiges Gewöhntsein an eine akademische Ausdrucksweise und die geistige Verarbeitung schwieriger analytischer Texte. Damit eignet sich dieses Werk nicht als Lektüre für durchschnittlich politisch Interessierte, sondern ist nur entsprechend vorgebildeten Menschen zu empfehlen, die sich gern mit den komplexeren Fragen der sozial-ökologischen Transformation beschäftigen. Wie nützlich, dass nach einem langen Hauptteil, in dem die Forschergruppe in beeindruckender handwerklicher Arbeit ihre methodische Vorgehensweise erläutert, im vorletzten Kapitel eine gut verständliche Zusammenfassung und Interpretation der Befunde ihrer Umfrage präsentiert. Die dann allerdings geeignet ist, auch einer breiteren Leserschaft die oftmals mühselige kognitive Erfassung der vielen methodischen Details und das Soziologenvokabular entweder zu ersparen oder jedenfalls verständlicher zu machen.
Die Datenbasis zur Beweisführung der These im Titel des Buches, dass wir es in Deutschland mit einem neuen sozial-ökologischen Klassenkonflikt um die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zu tun haben, holte sich die Autorengruppe aus der Befragung von 4000 Menschen ab 18 Jahren in Deutschland. In ihrem Auftrag wurde die Umfrage Ende 2021 seitens des Telefonumfragelabors der Uni Jena und des Befragungsinstituts NORSTA durchgeführt. Ziel war es, herauszufinden, wie die Menschen „den anstehenden Wandel, ihre Alltagsgewohnheiten, ihr gesellschaftliches und politisches Engagement und ihre soziale Lage“ sehen und empfinden. Von dem „neuen sozial-ökologischen Klassenkonflikt“ hierzulande sprechen die VerfasserInnen vor dem Hintergrund des politischen Streits um Heizungsgesetz, Verbrennerverbot, vorgeblichen Sparzwang, Tempolimit, Sich-Ankleben von KlimaaktivistInnen auf Straßen oder Flugplätzen, das Thema ‚Migration‘ und den schier unaufhaltsamen Aufstieg der AfD. Für seine Deutung ziehen sie alle Register ihres Fachs.
Bei seiner Analyse und methodischen Vorgehensweise hat das Quartett die Ansätze des verstorbenen französischen Soziologen Pierre Bourdieu und solchen in seiner Tradition verwendet, gilt doch der Franzose auf seinem Gebiet als bahnbrechend. Bei ihm spielt die Kategorie des „sozialen Raums“ eine grundlegende Rolle. Mit deren Hilfe lassen sich neben vertikalen Machtverhältnissen (Oben, Mitte, Unten) auch horizontale Ungleichheiten zwischen „Klassenfraktionen“ mit unterschiedlicher Stellung in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung analytisch erfassen und in einem Schaubild zweier Achsen darstellen. Die Vertikale markiert den sozialen Status, die Horizontale Bildung und Besitz. In die Sozialdaten der vorliegenden Untersuchung flossen 14 sozio-ökonomische Merkmale der Befragten mit insgesamt 71 Antwortoptionen ein. Das so erfasste Spektrum beinhaltet z.B. Informationen zu Einkommen, Haus-, Auto-, Land- und Aktienbesitz, Wohnfläche und Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage. Weitere Kategorien sind Beruf, Beruf des Vaters, Bildungsabschluss und Abschluss der Mutter, ferner sog. Strukturvariablen wie Geschlecht, Migrationserfahrung und Tätigkeit im öffentlichen oder privaten Sektor. In drei Blöcken hat man u.a. Fragen zu allgemeinen Haltungen und Einstellungen zu sozialen Beziehungen, dem eigenen Leben, ökologischen Fragen, zum gesellschaftlichen Wandel und dem Blick auf Natur gestellt. Dabei war für die Antwortmöglichkeiten des ersten Blocks eine Fünfer-Skala von voller Zustimmung bis „stimme überhaupt nicht zu“ – mit der neutralen Mittelkategorie „teil, teils“ – vorgegeben. Um eine hohe Repräsentativität für die Gesamtbevölkerung Deutschlands zu erhalten, wurden Quoten für Alter, Geschlecht und Bundesland festgelegt.
Es würde zu weit führen, tiefer ins Detail über die eingesetzten Analyseverfahren zu gehen. Es genügt, darauf hinzuweisen, dass die Gruppe aus den Daten der Befragten sog. Dimensionen grundlegender „‘Charakterzüge‘“ herausgefiltert hat, hieraus dann in einem anderen Verfahren sog. Mentalitätstypen konzipiert und diese anhand ihrer Einstellungen zu Transformationsfragen drei großen Spektren zugeordnete (ökosoziales, konservativ-steigerungsorientiertes, defensiv-reaktives Spektrum). Am Ende wurde mithilfe anerkannter statistischer Verfahren jeder einzelne der 4000 befragten Menschen im Schema des sozialen Raums als ein Punkt verortet, sodass die AutorInnen daraus eine „‘Landkarte‘ der Mentalitäten“ in der deutschen Bevölkerung entworfen haben, die für die Ergebnissicherung und Schlussfolgerungen aussagekräftig ist. In das Lagebild flossen dann noch vier sog. Konfliktdimensionen (Abstraktionskonflikt, Lebensweisekonflikt, Veränderungskonflikt, Externalisierungskonflikt) ein. Sie spiegeln die Verteilung der unterschiedlichen Bewertungen durch die Befragten im Sozialraum wider. Somit konnte ein Zusammenhang zwischen Mentalitäten (Denkweisen, Interessen, Bewusstseinslagen) und Sozialstruktur (sozioökonomische, materielle Situation / soziale Lage) hergestellt werden.
Das Fazit der ForscherInnen ist für KlimaaktivistInnen ernüchternd. Ihre Recherche entstand quasi inmitten der Corona-Pandemie (Datenerfassung im Herbst/Winter 2020/2021), der Bundestagswahlkampf fand statt, aus ihm ging die Ampel-Regierung hervor. Mit genau jenen Krisenerscheinungen in der Folge, die oben schon angerissen wurden, aber inzwischen (2025) um weitere besorgniserregende globale und nationale Entwicklungen ergänzt werden müssen: Ukrainekrieg, Wiederwahl Trumps, rapide fortschreitender Klimawandel, die palästinensische Tragödie, die Militarisierung der EU bzw. Deutschlands, Staatsschuldenkrise und Austeritätspolitik, Massenentlassungen, steigende Wohnungsnot, … ). Birgt aber diese historisch „falsche“ Entwicklungsrichtung nicht auch Chancen für eine transformatorische Wende, wenn die nach einer überzeugenden Lösung strebenden, emanzipatorischen Kräfte sich einigen und es klug anstellen, den jetzigen Stand des Bewusstseins (nach Eversberg& Co. die „Mentalitäten“) breiter Teile der abhängig Beschäftigten im Sinne der Transformation positiv zu beeinflussen? Den BuchautorInnen ist daher unbedingt zuzustimmen, wenn sie sich in ihrer Nachbetrachtung (Kap. 9) für eine neuerliche Datenerhebung aussprechen. Die Geschichte hat mehrfach gezeigt, dass sich das Bewusstsein breiter Massen in Krisen, Krieg und sozialen Katastrophen schnell ändern kann, Lernprozesse möglich sind und eine politische Radikalisierung mit starkem Veränderungsbedürfnis nicht nur nach rechts, sondern auch nach „links“ (Beispiel: Frankreich) möglich wird.
Bleibt zu skizzieren, warum die „Kernbefunde“ ihrer Erhebung das Soziologenkollektiv pessimistisch in die Zukunft blicken lassen: „Die sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft, das zeigen unsere Analysen genauso wie die politischen Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre, droht zu scheitern.“(S. 170) Voranzustellen ist diesem Fazit zunächst eine im Text erläuterte Studie der Harvard University von Ende 2023, also aus der abklingenden Phase der Pandemie, die Haltungen der Menschen zu klimapolitischen Maßnahmen in 20 Ländern untersuchte. Demnach wird zwar der Klimawandel in Deutschland von einer deutlichen Mehrheit (rd. 80%) als großes Problem begriffen, allerdings ist dieser Wert im Vergleich zu Ländern des Nordens unterdurchschnittlich. In anderen reichen (gemessen am Einkommen) Ländern ist der Wille zu Verhaltensänderungen ausgeprägter als in Deutschland, das hier im Mittelfeld landet. Unsere Mitmenschen zeigen sogar die niedrigste Zustimmung zu den klimapolitischen Instrumenten „grüne“ Infrastrukturprogramme, CO2-Besteuerung und Verbrenner-Aus. Aufschlussreiche Erkenntnisse unserer BuchautorInnen sind u.a.: Fast 25% der Befragten sehen die Bedenken von Naturschutzvereinigungen häufig als stark übertrieben an. Charakteristisch für die Reaktionen auf unterbreitete Vorschläge ist, dass ihnen nur so lange zugestimmt wird, wie sie nicht direkt das eigene Leben beeinflussen. Große strukturelle Veränderungen und ökonomische Umbaumaßnahmen für den Klima- und Umweltschutz werden auf einer sehr abstrakten Ebene befürwortet. Sobald aber die Folgen für die eigene Lebensweise ins Bewusstsein dringen, dahingehend, dass sich das eigene Leben verändern muss, treten in der Umfrage Befürchtungen bis hin zur Zurückweisung gesellschaftlichen Wandels zutage. Besonders bedenklich stimmt die ForscherInnen, dass die „Veränderungsanforderungen“ von einem wachsenden Teil der Bevölkerung mit Skepsis und Abwehr gegen Institutionen wie Medien und Wissenschaft beantwortet werden. Insgesamt wird in dieser Gemengelage ein hohes Konfliktpotenzial ausgemacht. Es scheint, dass steigender Technikoptimismus (63% wünschen z.B. eine schnellere Digitalisierung) ein Ausdruck davon ist, mittels als vielversprechend ausgegebener technischen Lösungen das Hinterfragen von Konsequenzen für das eigene Leben zu vermeiden.
Mut macht uns das Buch dennoch. Seine VerfasserInnen geben uns eine Reihe konkreter politischer Ratschläge, wie wir trotz der pessimistisch stimmenden Diagnose des Transformationskonflikts Hoffnung realisieren können. Um nur einige zu nennen:
1. Es muss klar sein, dass es bei der Transformation nicht um eine technologisch aufgerüstete Industrie geht, sondern um die Erneuerung der ganzen Gesellschaft hin zu ökologischer Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit, Inklusion und mehr Demokratie.
2. Wir sollten nicht moralisieren und appellieren, sondern notwendige politische Regulierungen transparent gestalten, demokratisch beschließen und für alle gleichermaßen verbindlich machen.
3. Fokussierung nicht auf die Verantwortung des Individuums, sondern auf die gesellschaftlichen Voraussetzungen nachhaltigen Agierens.
4. Sozial-ökologische Transformation ist nach dem Suffizienzprinzip anzulegen, nach dem wir Produktion und Verbrauch auf ein Niveau bemessen, das die wesentlichen materiellen und sozialen Bedürfnisse befriedigt und zugleich ökologische Grenzen nicht überschreitet.
5. Umbau der Strukturen der vorherrschenden Lebensweise, sozialen Arbeitsteilung und der Macht- und Herrschaftsverhältnisse, zugleich Beschränkung der Möglichkeiten, Lasten auf andere Menschen abzuwälzen.
6. Im gesellschaftlichen Diskurs: Verabschiedung von gewohnten „Argumentationsmustern“ und Denkweisen, die von den Einstellungen sozial privilegierter Interessengruppen geprägt sind.
Dem möchten wir an keiner Stelle widersprechen, nur die Gretchenfrage hinzufügen: Wer soll diese Strategie denn umsetzen, und vor allem, wie? Von den systemtragenden Parteien (Union, FDP, SPD, Grüne, AfD) haben wir keine solche Lösung zu erwarten. Im Gegenteil, die (extreme) Rechte ist schneller und finanzstärker als wir, dazu medial hofiert, Deutschland driftet weiter nach rechts.